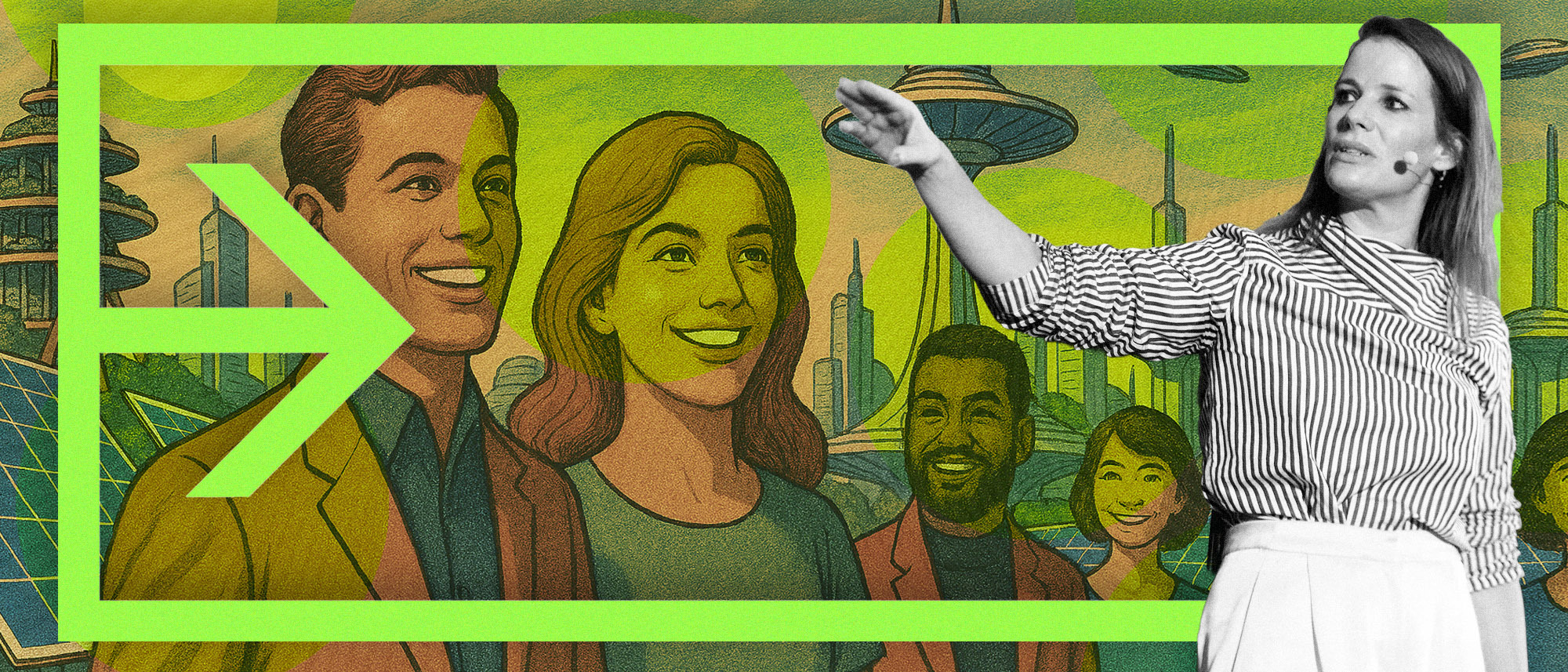
So schlimm wie jetzt war die Welt noch nie? Falsch, sagt Florence Gaub
Kriege, Trump, Klimakrise: Die Welt scheint in einem desolaten Zustand zu sein. Gerade in Deutschland schauen die Menschen pessimistisch in die Zukunft. Aber ist das wirklich angebracht? Beim Festival der Zukunft in München plädiert die Zukunftsforscherin Florence Gaub für mehr Optimismus, präsentiert überraschende Statistiken aus der ganzen Welt und rät zur „Informationshygiene“.
Von Wolfgang Kerler
Mit ihrem Team am NATO Defense College in Rom entwickelt Florence Gaub Szenarien für die Zukunft. „Horrorszenarien“, wie sie selbst sagt. Wie könnten neue Weltkriege ablaufen? Welchen Schaden würden Atombomben im Weltall anrichten? Düstere Fragen, die für sie Alltag sind. „Aber es geht nicht nur darum, dass ich mir das vorstelle“, erklärt die Zukunftsforscherin. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht stattdessen die Frage: „Was kann man tun, damit das nicht passiert?“
Florence Gaub, die mit ihrem Beststeller Zukunft: Eine Bedienungsanleitung und Auftritten bei Markus Lanz & Co. inmitten von Kriegen, geopolitischen Spannungen und Regierungskrisen unideologisch für Optimismus und gegen Zukunftsangst plädiert, ist Anfang Juli 2025 nach München gekommen – zum Festival der Zukunft von 1E9 und Deutschem Museum. Ihr einstündiger Auftritt geht langsam zu Ende. Jemand aus dem Publikum will wissen, wie sie es schafft, trotz ihres Jobs optimistisch zu bleiben. Die Antwort: Nicht nur Horrorszenarien, sondern auch Möglichkeiten sehen. Und dann handeln.
„Je mehr man sich bewusst macht, was man eigentlich tun kann, desto stärker fühlt man sich und desto optimistischer ist man“, erklärt sie. „Und je mehr Optimismus man hat, desto mehr tut man dann auch wieder. Es ist eine Art positiver Teufelskreis.“ Für sie und ihr Team heißt das, zum Beispiel: Lücken im Sicherheitssystem finden – und Wege finden, wie sie geschlossen werden können. Dramatischen Ereignissen vorbauen, anstatt sich davor zu fürchten.
Die Menschen in Deutschland sind eher pessimistisch. Schon lange.
Ihren Vortrag beginnt Florence Gaub mit zwei Fragen ins Publikum. Wer ist für seine eigene Zukunft optimistisch? Fast alle Hände gehen nach oben. Und wer ist für die Zukunft Deutschlands optimistisch? Höchstens ein Drittel der über 200 Leute meldet sich noch. Das Ergebnis ist nicht repräsentativ, für die Expertin aber nicht überraschend. „Das nennt man in der Zukunftsforschung Lokaloptimismus versus Nationalpessimismus.“
Mit fundierten Zahlen aus der ganzen Welt unsere Perspektive zurechtrücken – darum geht es der Wissenschaftlerin, die neben der NATO auch die EU berät, aber auch der World Science Fiction Society angehört, bei ihrem Auftritt in München. Unter dem Titel „Zukunft weltweit: Was wir von anderen Ländern lernen können“ stellt sie Statistiken vor, die sie bei ihren Recherchen gefunden hat. Sie wollte herausfinden, wie Menschen in unterschiedlichen Ländern und Regionen auf die Zukunft schauen.
Der Ausgangspunkt dabei: Deutschland. Hier blickt eine Mehrheit laut einer Umfrage der Schufa seit Jahren „eher sorgenvoll“ oder sogar „mit sehr großer Angst“ in die Zukunft. Warum sie diese Grafik zeige? „Weil ich das Gefühl habe, die Nachrichten sagen: So schlecht wie jetzt war es noch nie.“ Doch wenn man weiter in die Vergangenheit gehe, stelle man fest: Die Menschen in Deutschland blicken schon immer sorgenvoll in die Zukunft. „Das ist eine gute Nachricht“, meint Florence Gaub. Denn es bedeute, dass wir uns derzeit nicht in einem historischen Ausnahmezustand befinden.
Ich möchte so wahnsinnig gerne mit diesem Mythos aufräumen, dass es so schlimm wie jetzt noch nie war.
Das untermauert sie auch durch Zahlen aus anderen Ländern, zum Beispiel den USA, wo es immer wieder Phasen gab, in denen die Menschen mehrheitlich nicht mit der Richtung des Landes zufrieden waren. „Ich möchte so wahnsinnig gerne mit diesem Mythos aufräumen, dass es so schlimm wie jetzt noch nie war“, sagt Florence Gaub. „Und zwar aus einem einfachen Grund: Ich nenne das ,geschichtlichen Kolonialismus‘. Das negiert die Leiden unserer Vorfahren.“ Es sei einfach nicht wahr, dass die Vergangenheit super war.
„Das heißt nicht, dass wir nicht jetzt Herausforderungen haben. Aber was ist Problem daran, wenn man sich selbst sagt: So schlimm wie jetzt war es noch nie? Das heißt, niemand vor uns hat schonmal sowas geschafft. Und dann disempowered man sich selbst.“ Man nehme sich selbst die Fähigkeit zu sagen: „Okay, das ist jetzt schwierig, aber wir kriegen das hin.“ Doch das sei die Haltung, die wir jetzt brauchen.
Der Faktor Einkommen: Je reicher desto pessimistischer
Eine weitere Erkenntnis: Jüngere Menschen sind im Schnitt optimistisch, auch wenn Medienberichte immer wieder das Gegenteil nahelegen. Bei einer Befragung in 21 Ländern seien 54 Prozent der 15- bis 24-Jährigen der Meinung gewesen, dass es den Kindern in ihrem Land wirtschaftlich einmal besser gehen wird als ihren Eltern. Sogar 57 Prozent der jungen Menschen sagen demnach, die Welt werde insgesamt ein besserer Ort. Bei den Befragten in Indonesien sind es sogar 82 Prozent – Spitzenreiter. „Wir sehen: Jüngere Menschen auf der Welt sind nicht so pessimistisch wie der Durchschnitts-Deutsche.“
Selbst beim Thema Klima sei die Mehrheit der jungen Menschen der Ansicht, dass die Weltgesellschaft in der Lage ist, den Klimawandel einzugrenzen. Allerdings ist dieser Optimismus laut den Zahlen, die Florence Gaub präsentiert, in Lateinamerika und Asien größer als in Europe. Auch das ist ein Muster, dass sich durch verschiedene Befragungen zieht.
„Je mehr Geld man hat, desto pessimistischer ist man.“ Und das gelte auch für junge Menschen, erklärt die Zukunftsforscherin. Während in reichen Ländern 59 Prozent der Jugendlichen davon ausgingen, es einmal schlechter zu haben als ihre Eltern, gingen in ärmeren Ländern 69 Prozent davon aus, einmal besser dazustehen. „Liegt es daran, dass man viel zu verlieren hat, oder liegt es daran, dass man nicht weiß, was man jetzt noch von dieser Zukunft will, wenn man schon viel hat? Ich glaube, das ist eine philosophische Frage.“ Weitere Zahlen belegen, dass in den USA Minderheiten, die es politisch und wirtschaftlich eigentlich schwieriger haben, optimistischer sind als die weiße Bevölkerung.
Vielleicht ist eine gute Gegenwart hinderlich bei der Vorstellung der Zukunft als etwas, was man erobern möchte.
Was das alles bedeutet? „Das heißt, dass man keine super Gegenwart braucht, um eine gute Zukunft zu haben. Vielleicht eher das Gegenteil. Vielleicht ist eine gute Gegenwart hinderlich bei der Vorstellung der Zukunft als etwas, was man erobern möchte, wo man etwas Positives hineinprojiziert.“
Seit den 2000ern macht sich Ungewissheit breit
Zum Schluss präsentiert Florence Gaub EU-weite Befragungen, die sich mit ihrer Publikumsbefragung decken: Menschen sind, was die wirtschaftliche Zukunft ihres Landes angeht, pessimistischer als für ihre persönliche Zukunft, wo die meisten mit Stabilität oder Verbesserung rechnen. „Wir haben alle für uns selbst einen Grundoptimismus.“ Doch woher kommen dann Aussagen wie „Deutschland geht den Bach runter“? „Ich bin ganz sicher, dass das eher eine Aussage darüber ist, wie wenig Einfluss wir darauf haben.“
Dass wachsende Angstgefühl auf kollektiver Ebene lasse sich seit den frühen 2000ern nachweisen, was die Wissenschaftlerin auf zwei Dinge zurückführt: das Internet und die Globalisierung. Das Internet führe zu einer Flut an Informationen, die Globalisierung zu Unübersichtlichkeit. Seit dieser Zeit mache sich daher Ungewissheit breit. „Aber Ungewissheit ist nicht per se etwas Schlechtes. Ungewissheit ist neutral als Ausdruck. Es heißt einfach nur: Ich kann es nicht genau sagen. Und der Mensch hasst es, wenn er etwas nicht genau sagen kann.“
Ihre Ratschläge gegen Zukunftsangst: Informationshygiene. „Sie nehmen heute an einem Tag mehr neue Informationen auf als ein Bauer im Mittelalter im ganzen Leben.“ Iran, Gaza, Ukraine – direkt aufs Handy. „Ist das für Sie relevant an einem Samstag in München?“ Anstatt ungezügelt Informationen zu konsumieren, rät Florence Gaub zum Clustern. Nachrichten einmal morgens, vielleicht mittags und noch einmal abends – nicht ununterbrochen. „Das kreiert nur noch mehr das Gefühl der Unsicherheit, weil Ihr Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Gaza und Taufkirchen.“